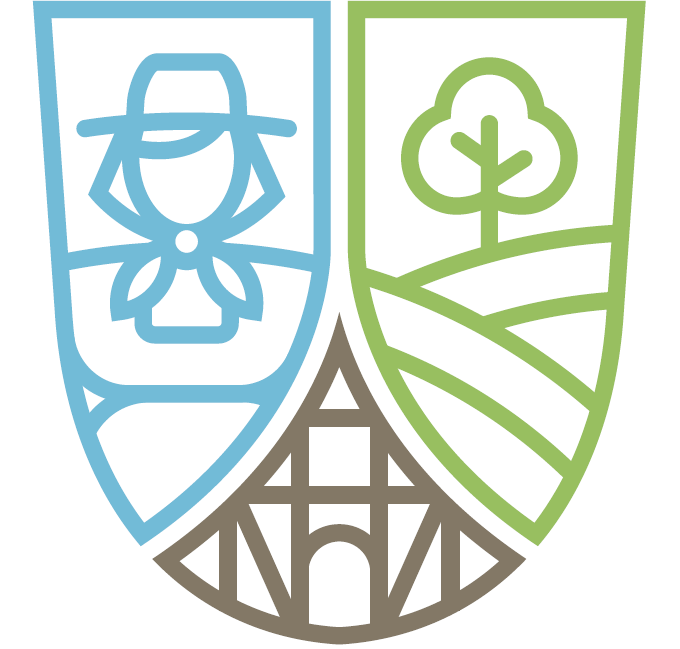Holz, Wasser oder Eis: Die zukünftige Wärmeversorgung des FMO

Die Eingangsgebäudes des Freilandmuseums wurden in den 1990er Jahren errichtet. Damals setzte man – noch mit großer Selbstverständlichkeit – auf eine Ölheizung. Zwar hat sich die Anlage aufgrund ihrer langen Betriebsdauer als relativ nachhaltig erwiesen, dennoch ist die Heizung langsam am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Es stellt sich nun die Frage, wie wir in Zukunft das Verwaltungsgebäude, das Ausstellungsgebäude und das Hausmeisterhaus mit Wärme und Warmwasser versorgen können.
In den neueren Gebäuden des Museums, etwa dem Zentraldepot oder auch dem Handwerkerhof sind bereits seit über 2012 Wärmepumpensysteme im Einsatz. Das Zentraldepot wird über eine Tiefengeothermieanlage mit Wärme versorgt, der Bauhof mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, wie man sie mittlerweile auch aus Wohngebäude kennt. Auch das derzeit geplante Großobjektedepot wird an das bestehende Geothermiesystem angeschlossen werden.
Der Bezirk Oberpfalz hat sich mit seinem integrierten Klimaschutzkonzeptes das Ziel gesetzt, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Im Zuge der Erarbeitung dieses Rahmenplans wurde auch der Tausch der bestehenden Ölheizung des FMO in den Maßnahmenkatalog aufgenommen. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck des Museums so weit wie möglich zu verkleinern. Allerdings entbindet dies nicht von einer ökonomischen Bewertung. Im Rahmen der nun von der Energieagentur Regensburg e.V. erarbeiteten Studie wurde deshalb der Einbau eines Heizöl-Brennwertkessel mit 85 KW Leistung als Referenzvariante betrachtet. Folgende Frage galt es zu beantworten:
- Wie stellt sich die IST-Situation aus energetische Sicht bezüglich Verbrauch, Gebäudehülle, Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung im FMO dar?
- Wann wird wie viel Wärme benötigt?
- Gibt es günstigere und umweltfreundlichere Arten der Wärmegewinnung im Vergleich zum Referenzfall?
- Welche Auswirkungen hat dies auf die Wärme- und Warmwasserverteilung und die Gebäudehülle?
- Macht die Errichtung eines saisonalen Wärmespeichers , zum Beispiel als Sand-Kies-Speicher oder als Eisspeicher Sinn?
- Wie hoch sind die CO2-Einsparpotentiale?
- Wann amortisieren sich die einzelnen Varianten?
Die nun vorliegende Studie kommt zum Ergebnis, dass die Wärmeerzeugung mit einem Pelletkessel oder einer Luft-Wärmepumpe am wirtschaftlichsten ist. Allerdings unterscheiden sich die beiden Varianten im Hinblick auf die Kostenzusammensetzung: Eine Pelletheizung hat zwar geringerer Investitionskosten, dafür aber höhere Betriebskosten. Eine Wärmepumpe ist im Betrieb hingegen deutlich günstiger, dafür teurer in der Anschaffung. Bewertet man die Systeme auch noch ökologisch, so ist die Wärmepumpe – auch beim derzeitigen Strommix – die nachhaltigste Variante zur Wärmeerzeugung für die drei Eingangsgebäude.
Im Bezug auf die Gebäudehülle kommt die Studie zum Ergebnis, dass es zwar Sinn macht, die Fenster und Türen zu ersetzen, aber die Gebäudehülle nicht anzufassen, da die Einsparungen für eine Dämmung nicht im Verhältnis zu den Kosten und den Einsparpotentialen stehen. Hintergrund ist, das der Dachüberstand der Gebäude zu gering ist, um außen noch eine Dämmung anbringen zu können. Es müssten also die Dachkonstruktionen geändert werden, was entsprechend aufwendig ist.
Im nächsten Projektschritt soll ein Fachplaner eine Ausführungsplanung samt detaillierter Kostenberechnung erarbeiten. Das Freilandmuseum Oberpfalz hat bereits vor zwei Jahren für die geplante energetische Sanierung eine Förderung in Höhe von 1 Million Euro seitens der EU, genauer gesagt des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zugesagt bekommen.
Die Studie wurde gefördert über die Richtlinie zur Förderung von Energiekonzepten und kommunalen Energienutzungsplänen durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Energetische Sanierung schreitet voran! – 2025 – Pressemitteilungen – Freilandmuseum Oberpfalz